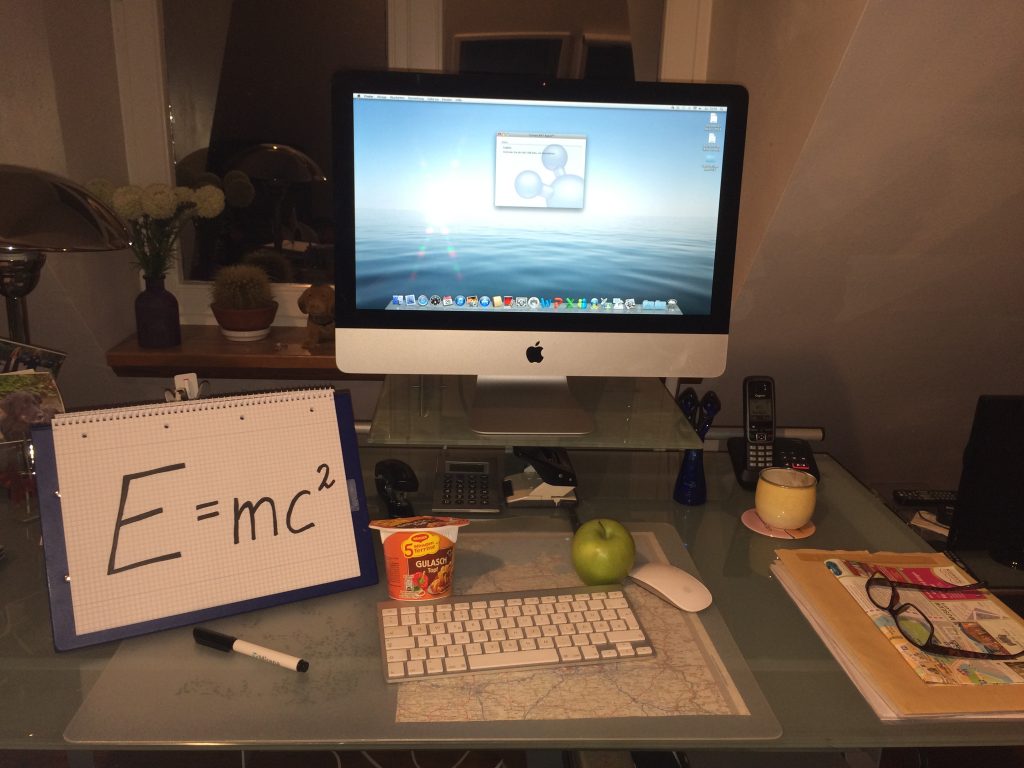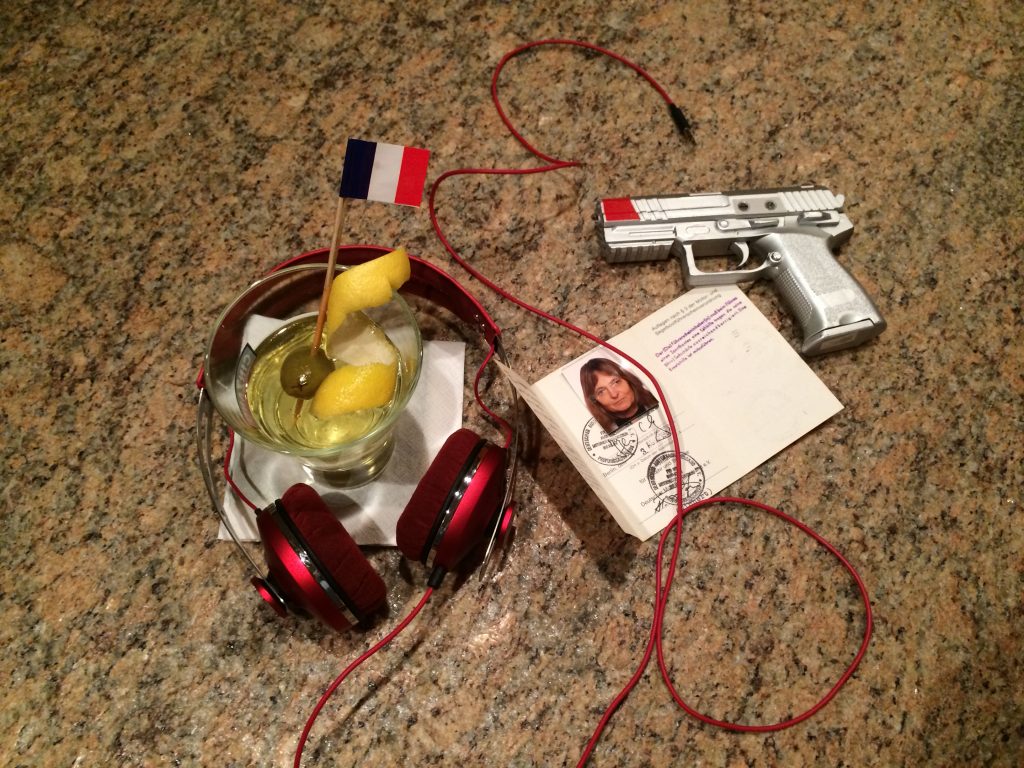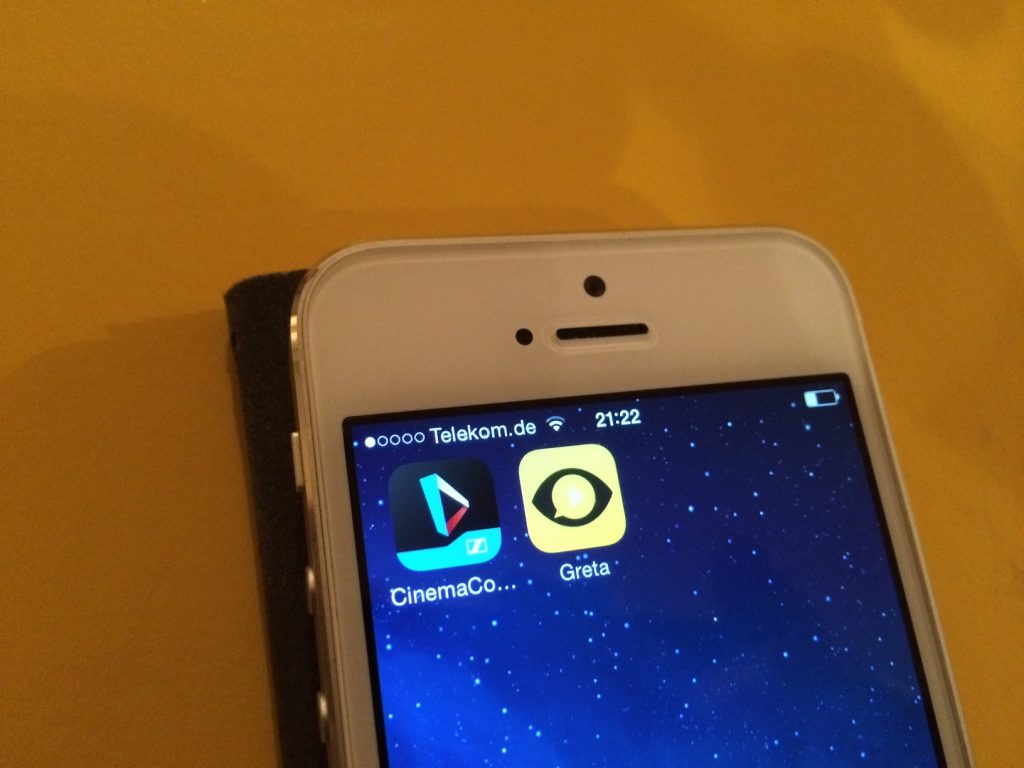Schon vor 50 Jahren konnte die deutsche Schlagersängerin Marion Maerz in der ZDF-Hitparade ein Lied davon singen, daß er wieder da ist. Damals schüttete sie zu der moll-lastigen Melodie ihr Herz natürlich nicht über den da aus, der sich gerade durch die deutsche Kinolandschaft demagogisiert, sondern über den da, der zwar wieder da ist, aber leider eben nicht bei ihr. Jetzt ist ihr größter Hit wieder da, weil die Filmemacher von „Er ist wieder da“ die letzten Filmminuten mit genau diesem gleichnamigen Schlager ausklingen lassen. Da liegt er also plötzlich im Sommer 2014 rücklings wie ein gestrandeter Maikäfer, auferstanden aus Ruinen, in seiner ramponierten Nazi-Uniform auf dem Boden irgendeiner Berliner Baulücke. Wer eigentlich? Es ist der da, der sich am 30. April 1945 feige und selbstbestimmt im Führerbunker ins Jenseits beförderte. Nach dem Motto „Totgeglaubte leben länger“ ist der Führer als 56-jähriger wieder da und staunt genauso wie die Zuschauer, wie das vonstatten gegangen sein könnte. Er stellt schnell fest, daß er der einzige des Naziregimes ist, der wieder da ist, und begreift so nach und nach, in welche Zeit es ihn katapultiert hat. Aber Hitler kapituliert vor den damit verbundenen Herausforderungen genauso wenig, wie er 1945 einer Kapitulation des deutschen Reiches zustimmte. Er beginnt, Kapitel für Kapitel die Veränderungen seiner Umwelt seit der Kapitulation zu entdecken, interpretiert diese für sich aber recht eigenwillig. Beim Verzehr eines Müsliriegels, wie er meint „gepreßtes Korn“, schließt er auf immer noch bestehende Versorgungsengpässe. Wegen der auffälligen Präsenz türkischer Landsleute stellt er zunächst wohlwollend fest, daß der einst unentschlossene türkische Kriegsverbündete dem Deutschen Reich doch noch zu Hilfe gekommen sein muß. Bei seinem Rundumschlag durch die politische Landschaft stellt er allen außer den Grünen ein gleichermaßen vernichtendes Urteil aus. Wenn überhaupt, ist es die grüne Landschaftspfleger-Partei wert, ihm bei seiner erneuten Machtergreifung Hilfsdienste zu leisten. Die teuflisch gute Idee, die Zustände des heutigen Deutschland aus der Sicht dieses kranken Hirns zu analysieren, hatte der deutsche Journalist, Buchautor und Übersetzer Timur Vermes. In seinem 2012 erschienenen Buch „Er ist wieder da“ treibt Vermes diese Idee auf die Spitze. Er läßt Hitler vermeintliche Probleme erkennen, seltsame Lösungswege entwickeln und in Führermanier durchsetzen. Christoph Maria Herbst gelingt es in dem Hörbuch, die schauderhafte Stimme so gut zu imitieren, daß man meinen könnte, vor einem Volksempfänger dem neuesten Wahnsinn des Reichskanzlers zu lauschen. Im Film übernimmt Oliver Masucci die Führerrolle. Ihm gelingt es nicht nur, so schauderhaft zu sprechen, sondern auch noch so auszusehen, eben so wie in einer Ausgabe der Wochenschau 2014. Deshalb liegt sein Wiedererkennungswert bei allen, auf die er trifft, bei 100 Prozent, und weil nicht sein kann, was nicht sein kann, halten ihn alle für einen neuen, noch nicht entdeckten Kometen am Comedianhimmel. Recht schnell entdeckt ihn die Medienwelt als den größten Führerimitator und rock zock demagogisiert er vor laufenden Kameras in der Talkshow eines Privatsenders das Publikum. Demagogie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Volk und Führen. Der Demagoge in der Antike war ein angesehener Redner und Führer des Volkes bei politischen Entscheidungen. Ihren Höhepunkt erfuhr die Demagogie im 20. Jahrhundert als Mittel der Ideologisierung der Massen und das führte zu dem totalen Imageverlust des ursprünglich positiven Begriffs. Hitler war zu seinen eigentlichen Lebzeiten ein Meisterdemagoge und schürte aus Machtgier methodisch Emotionen und Vorurteile seiner Zuhörerschaft. Es ist mir ein Rätsel, wie er mit dem schrecklich gerollten r und seiner kehligen Brüllstimme, mit der er seine Schrecklichkeiten wortweise eher herausspuckt als spricht, die Massen so in seinen Bann ziehen konnte. In dem Kinderbuch „Urmel aus dem Eis“ gibt es einen See-Elefanten namens Seele-Fant. Er liegt den ganzen Tag einsam auf einer Eisscholle vor der Insel Titiwu und seine Lieder klingen deshalb besonders trübselig, weil er die Vokale umlautet, also verändert. Der Ex-Diktator hat einen verblüffend ähnlichen Sprachtick wie der traurige Seele-Fant. In der Jetztzeit genießt er in den Talkshows als vermeintlicher Imitator des Führers eine Narrenfreiheit, die er gnadenlos für seine Propagandazwecke ausnutzt. Den Verantwortlichen hinter der Kamera stockt schon manchmal der Atem, mir übrigens auch, aber man läßt ihn gewähren, wie damals! Als ob das nicht schon genug wäre, setzt der Regisseur und Drehbuchautor David Wnendt noch einen drauf! Das Hitler-Double wird, begleitet von dem Fernsehfritzen Sawatzki (Fabian Busch), auf das real existierende heutige deutsche Volk losgelassen. Von dem so gewonnenen Doku-Material werden ca. 25 Minuten in den Film gestreut. Was dabei herauskommt, reicht von unglaublich, erschreckend bis haarsträubend und ganz selten auch witzig. An dem einsamen Fremden neben mir im Kino konnte ich spiegelbildlich wunderbar das Wechselbad seiner und meiner Gefühle beobachten: Mal herzhaftes Lachen, dann das Lachen, das im Hals steckenbleibt, manchmal verzweifeltes Aufstöhnen. Als ob die Welt nicht schon mit den bedruckten Seiten namens „Mein Kampf“ genug gestraft wäre, beginnt Hitler, inzwischen recht gut mit der Errungenschaft des Computers vertraut, wieder, geduldiges Papier zu beklecksen. Unter der Federführung der Medienfrau Bellini (Katja Riemann), die er in einem Atemzug mit Leni Riefenstahl nennt, wird die Chose dann auch noch verfilmt. Ohne die Hörfilmbeschreibung über Greta, meinen Rettungsanker, hätte ich spätestens bei dem Film im Film den Überblick verloren. Aber gemeinsam haben wir das problemlos hinbekommen. Die Sprecherin bewahrte auch bei noch so absurden Turbulenzen mit ihrer wohltuenden Stimme die Ruhe und war immer zur richtigen Zeit mit den wichtigen Informationen zur Stelle. Verlassen habe ich das an einem sonnigen Sonntagnachmittag bis auf den letzten Platz ausverkaufte Kino mit einem lachenden und einem nachdenklichen Auge. Auf daß er niemals mehr da sein möge!